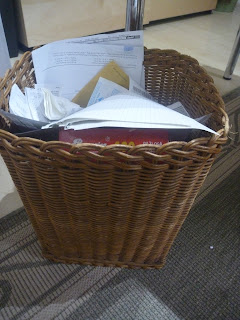Eine ist hier im Blog bis jetzt definitiv zu kurz gekommen: Tante Liesbet. Das "e" bei der Tante fällt irgendwie immer der Umgangssprache zum Opfer.
Liesbeths voller Name war Anna Auguste Elisabeth Schwentker, und diesen Namen hat sie auch nie geändert. Sie hatte auch keinen Grund dazu, denn sie hat nie geheiratet.
Liesbeth war eine der jüngeren Schwestern meines Großvaters. Sie wurde am 30.01.1912 im Haus Engerstraße 25 (damals Werther Nr. 203, heute Engerstraße 57) in Werther geboren, und in Werther ist sie am 27.07.1968 auch gestorben.
Böse Zungen könnten nun behaupten, dass Liesbeth nicht weit gekommen sei, aber bei genauerem Hingucken merkt man, dass das nicht der Fall ist.
Ganz abgesehen davon, dass wir heute wissen, dass es kein Makel ist, wenn eine Frau nicht heiratet: Sie musste es auch gar nicht. Und sie musste es nicht, weil sie - im Gegensatz zu ihren Schwestern und den meisten anderen Frauen ihrer Generation - einen Job hatte, der sie ernähren konnte. Was eine potenzielle Ehe angeht: Es gabe wohl Angebote, aber mein Vater, der sie ja im Gegensatz zu mir noch gekannt hat, erzählte immer, dass sie ihre (ältere!) Schwester Luise nicht allein lassen wollte, mit der sie in ihrem Haus in der Neuen Straße zusammengewohnt hat. So ganz hat das am Ende nicht geklappt, denn Luise hat sie überlebt.
Liesbeth hat bei Poppe und Potthoff gearbeitet, in Werther immer nur kurz P&P genannt. Bei uns in der Familie wird erzählt, sie sei praktisch die Privatsekretärin von Anneliese Potthoff gewesen, der Gattin des Chefs Hermann Potthoff. Es gab zwar auch noch den "anderen" Chef, Friedrich Poppe, aber soweit ich weiß, war der mit seiner Familie nie wirklich in Werther ansässig. Korrekturen an dieser Stelle nehme ich aber immer gerne entgegen. Herrn Poppe findet man heute noch nichtmal mehr in der englischen Übersetzung der P&P-Homepage.
Die Herrn Poppe und Potthoff haben im Jahr 1928 einen "Spezial-Betrieb für die Erzeugung von kaltgezogenen Präzisions-Stahlrohren in nahtloser und autogen geschweißter Ausführung" gegründet; so steht es zumindest auf ihrer Homepage. Die Firma und auch einen Großteil des Firmengeländes gibt es in Werther immer noch auf dem Grundstück zwischen Engerstraße, Nordstraße, Speckfeld und Wiesenstraße. Zur Arbeit hatte Liesbeth also nun wirklich nicht weit: 250 Meter Luftlinie.
Viel mehr gibt die Homepage inzwischen nicht mehr her; leider findet man zur Geschichte des Unternehmens nur noch einen relativ kurzen Text, der ziemlich nichtssagend ist, und ein paar Bilder von den akquirierten Unternehmen und Fertigungsstätten im Ausland und den aktuellen Produkten, die eben nicht mehr in Werther gefertigt werden . Vor ein paar Jahren war das noch anders. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in einer Mußestunde mal ein bisschen im Netz unterwegs war und per Zufall auf der Seite gelandet bin. Und da habe ich auch die folgenden beiden Fotos gefunden:
Da ist Liesbeth, direkt in der Mitte. Nicht die mit den Zöpfen, sondern die etwas Kernige rechts daneben, die dem adrett gekleideten jungen Mann, der sie halb verdeckt, über die gepolsterte Schulter seines Zweireihers guckt.
Auf diesem Foto scheint sie dann schon ein bisschen älter zu sein, Und auch ihre Ausstrahlung hat sich wesentlich verändert. Nicht nur, dass sie nicht einfach eine weiße Bluse oder ein weißes Kleid trägt wie auf dem ersten Bild, nein - Liesbeth trägt jetzt einen auf Taille geschnittenen Blazer mit prominentem Kragen und kombiniert eine auffällige Kette dazu. Auch die Art, wie sie da steht - so aufrecht, die Hände auf dem Rücken zusammengenommen - spricht für ein ruhiges, gesundes Selbstbewusstsein. Sie scheint auch kein Problem damit zu haben, in der ersten Reihe zu stehen und in die Kamera zu lächeln...
Leider hat P&P diese historischen Fotos wieder aus dem Netz genommen, so dass ich nicht mehr nachvollziehen kann, in welchen Jahren und in welchem Zusammenhang sie jeweils entstanden sind. Ich hätte es mir aufschreiben sollen, habe es damals aber gelassen, weil ich wusste, wo ich die Infos finden würde. Flötepiepe, wie man so schön sagt. Aber immerhin habe ich sie mir damals abfotografiert, weil ich sie aus irgendeinem Grunde nicht speichern konnte, was auch die schlechte Qualität der Bilder erklärt. Wieder 'ne Lektion gelernt.
Gerade, wenn ich dieses zweites Foto sehe, dann finde ich es unheimlich schade, dass ich Liesbeth auf dieser Welt verpasst habe. Sie ist leider nicht alt geworden, nur 56, aber mit Ausnahme ihrer älteren Schwester Marie waren alle Schwentker-Kinder in dieser Generation leider nicht sonderlich langlebig, weshalb auch immer. Ihr ging es den Erzählungen nach übrigens ähnlich wie mir, sie hatte schon Babysachen für mich gekauft, in der Hoffnung, dass ich mich irgendwann mal ankündige. Augenscheinlich in einer neutralen Farbe, denn die Strampler hat mein Großcousin bekommen - der war halt schneller als ich...