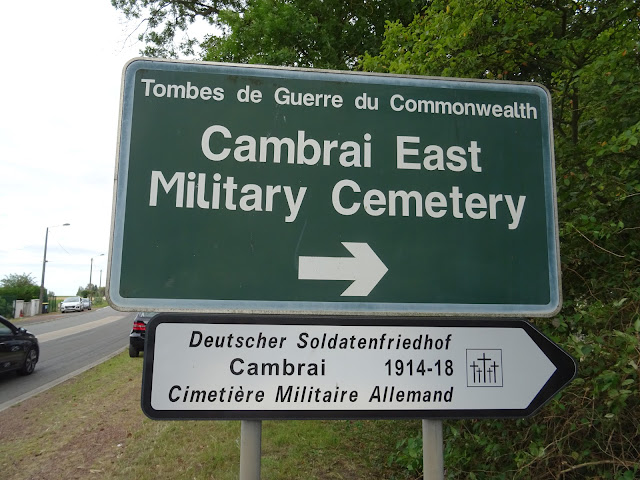Es gibt schon merkwürdige Zufälle: Nur ein paar Tage nach meinem Ausflug nach Tatenhausen verschlug es mich nun zum nächsten Schloss, um genauer zu sein: Zum Schloss Brincke in Barnhausen.
Dieser Schatten in Form einer Bierflasche, das bin ich. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe...
Dieses Mal war ich mit der VHS unterwegs - und mit meiner Mama. Hat auch mal wieder Spass gemacht!
Brincke ist genauso wie Tatenhausen ein Wasserschloss, nur mit einem doppelten Wassergraben. Erbauer waren die Herren von Brincke, aber ab 1439 übernahmen die Grafen von Kerssenbrock. Die hatten im 18. Jahrhundert ein Problem: Es fehlte ein Erbe. Der letzte "echte" Kerssenbrock, Ferdinand, war - nachdem er weit in Europa herumgekommen war - Dompropst in Osnabrück und verstarb dort auch 1754 kinderlos. Sein Bruder Matthias Caspar war schon 1746 ebenfalls ohne Nachwuchs gestorben. Man wusste also, was kommen würde, und man konnte sich etwas einfallen lassen. Die "Nachbarn" aus Tatenhausen und Verwandten mütterlicherseits, die Korff-Schmisings, sprangen ein, und zwar in Person von Ferdinands Vetter Friedrich Ferdinand. Ab da waren die Brincker Freiherren dann die von Korff-Schmising genannt Kerssenbrock. Später heirateten dann noch die Praschmas ein, ein mährisches Adelsgeschlecht. Damit führen die Brincker nun offiziell den Nachnamen von Korff gen. Schmising-Kerssenbrock-Praschma. Um es mit den Worten der Frau Gräfin, die die Führung übernommen hatte, zu sagen:
"Wir sind der Albtraum jedes Standesbeamten. Die Formulare sind immer zu kurz."
Sie musste dabei lachen. Fand ich sehr sympathisch. (Und nein, es war nicht dieselbe Gräfin wie in Tatenhausen. Aber irgendwie sind es wohl immer die Frauen, die die Führungen übernehmen. Ob die sich wohl absprechen?)
Ich bin auch schon einmal in Brincke gewesen, aber das ist ungefähr 40 Jahre her. Wandertag mit der Grundschule. An das Anwesen selbst konnte ich mich nicht mehr erinnern, mit einer großen Ausnahme:
Der Rest der Anlage wirkt allerdings wesentlich freundlicher; das muss ich jetzt hier mal festhalten. Eingebettet ist das ganze in einen auch heute noch funktionierenden landwirtschaftlichen Betrieb, und das ist auch der erste Eindruck, wenn man auf Brincke zu fährt. Hat man den makaberen Teil hinter sich gebracht, findet man sich in erstmal in einem Innenhof wieder, von dem man dann den Blick auf das eigentliche Schloss hat - und auf die Kapelle.
Das hier ist das Tor, durch das man in den Innenhof kommt. Keiner weiß, weshalb man das Steingebäude mit Fachwerk weitergebaut hat - oder war es umgekehrt?
Das hier ist der "lange Jammer". Das "lang" erklärt sich praktisch von selbst, wenn man sich den Grundriss des Gebäudes vor Augen führt. Der "Jammer" dürfte dadurch entstanden sein, dass in früheren Zeiten genau hier der Zehnte abgeliefert werden musste. Das Pony hier steht auf dem Weg zur Kapelle.
Am spannendsten fand ich das hier: Es ist der Eingang zum Museum/Archiv. Man sieht es: Das Gebäude rechts ist noch sehr neu, erst ungefähr vier Jahre alt, und damit die neueste Ergänzung des Gebäudeensembles. Das Merkwürdige ist: Es passt nicht nur dahin, es fügt sich auch ein, obwohl es ja nun wesentlich jünger ist als alle anderen Bauwerke auf dem Gelände. Ich mag ja diesen Kontrast von alt und neu. Im Erdgeschoss befindet sich ein kleines Museum, im ersten Stock dann das Archiv.
Insgesamt ist das ein schönes Beispiel dafür, wie man so eine Schlossanlage weiterentwickeln kann, ohne dass etwas verloren geht. Irgendwie hat man den Eindruck, dass jede Generation etwas hinzufügt. Um wieder Frau Gräfin zu zitieren:
"Wir denken hier in Generationen."
Ja, das merkt man.
Eine, die etwas sehr Markantes hinzugefügt hat, war übrigens Anna, eine geborene von Spee. Ihr haben die Brincker ihre Kapelle St. Marien und St. Nikolaus zu verdanken, die im Gegensatz zu der in Tatenhausen ein eigenständiger und nicht gerade kleiner Bau ist. Auf dem Foto sieht man rechts das Haupthaus, links die Kapelle, und dazwischen findet sich das Museum.
Ja, in der Kapelle waren wir auch, ich habe aber keine Fotos gemacht.
Um ein Haar hätte es die Kapelle übrigens nicht gegeben, denn die gute Anna von Spee wollte erst gar nicht heiraten. Sie hatte eigentlich für sich geplant, ins Kloster zu gehen, und hat sich ziemlich lange gewunden, bis sie sich zu einer ehelichen Verbindung durchringen konnte. Zwischendurch hatte sie sogar angefragt, ob sich der Herr Graf Franz Xaver denn auch eine rein platonische Ehe vorstellen konnte. Nein, konnte er nicht, und selbst ihr eigener Bruder, ein Pater, musste ihr klarmachen, dass die Sache so nicht laufen würde. Anna hat sich dann doch entschlossen, das Risko einzugehen, aber nur unter der Bedingung, dass man eine Kapelle bauen würde. Hat man. Und in dieser Kapelle wird noch heute jede Woche die Messe gelesen, wenn auch die Anzahl der Teilnehmer inzwischen ziemlich überschaubar geworden ist.
Anna scheint jedenfalls ihren Frieden mit diesem Arrangement gemacht zu haben - sie und Franz Xaver hatten nach ihrer Heirat insgesamt elf Kinder...
Mein Fazit: Ein Besuch lohnt sich, aber man sollte auf jeden Fall die Führung mitmachen, damit man die Hintergründe auch versteht. Schon schön zu sehen, welche Kleinode man so in der Nachbarschaft hat.