Jetzt, wo es wärmer wird, die Sonne öfter mal hinter den Wolken auftaucht und die Tage wieder länger werden, packt es mich. Es muss frische Luft ins Haus, und der Staub, den Herbst und Winter hinterlassen haben, muss raus. Sei es der gefühlte, sei es der tatsächlich vorhandene.
Vor ein paar Tagen stand ich vor meinem doch etwas größeren Bücherregal in einer eher dunklen Ecke des Wohnzimmers. Ungefähr 1,50 Meter breit, knapp 1,80 Meter hoch. Wir haben im Wohnzimmer halt ziemlich niedrige Decken. Ich war auf der Suche nach einem ganz bestimmten Buch, von dem ich wusste, dass es irgendwo in diesem Regal stehen musste. Ich hatte es ja erst vor knapp einem Jahr gekauft und erstmal "zwischengeparkt". Und ja, ich lese tatsächlich noch Bücher in Papierform. Nicht immer, aber immerhin.
Wie sich dann herausstellte, hatte ich dieses Buch so dermaßen gut zwischengeparkt, dass ich vor dem völlig vollgestopften Regal stand wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berge und dieses verflixte Buch nirgendwo zu sehen war. Nur die Überzeugung, dass mein Gedächtnis mich bei Büchern im Normalfall nicht trügt, hielt mich aufrecht.
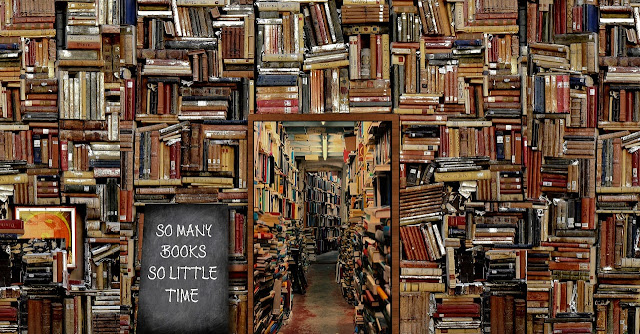
Abbildung ähnlich :-). Quelle: prettysleepy bei pixabay.com.
Das war dann der Punkt, an dem es mir reichte. Aber so richtig.
Ein "Schnauze-voll"-Moment.
Ich bin ziemlich rabiat an die ganze Sache rangegangen. Eine große Hilfe war dabei die Erkenntnis, dass viele der Veröffentlichungen des Historischen Vereins der Grafschaft Ravensberg, die sich überall auf den verschiedensten Regalbrettern tummelten, inzwischen online verfügbar sind, und zwar auf der Seite des Stadtarchivs Bielefeld. Alles bis einschließlich 2020(!) kann ich mir also bequem auf den Bildschirm ziehen, ohne dass das ich eine Papierversion entstauben müsste. Das gilt sowohl für die Jahresberichte als auch für die Ravensberger Blätter. Die nehmen als DIN/A 5-Heftchen zwar nicht allzu viel Platz weg, aber mein Problem war, dass sie halt überall in dieser Regalwand verteilt waren zwischen historischen Abhandlungen und Romanen, dem einen oder anderen Krimi - hauptsächlich französisch, englisch oder skandinavisch - und vor allem zwischen zig anderen DIN/A 5-Heftchen, denn ich habe die Angewohnheit, mich gerne in Museen etc. mit Material einzudecken, damit auch ja nicht vergesse, was ich alles schon gesehen habe. Dann kommen noch ein paar Reiseführer dazu, ein paar Fachbücher über Reptilien und Amphibien (mit einem Schwerpunkt auf Schildkröten), und ein paar Bildbände zu Im- und Expressionismus, Bauhaus, ... im Grunde viel zu viel Zeugs für so eine kleine Ecke.
Viel zu tun also.
Die Entfernung der Jahresberichte hat mir wirklich Luft verschafft und viel ausgemacht. Ein paar uralte Krimis in Taschenbuchversion, von denen ich schon vor zehn Jahren eher halbherzig davon ausgegangen bin, dass ich sie bestimmt nochmal irgendwann lesen würde und die ich seitdem nicht mehr angerührt habe, flogen hinterher. Gut, dass mein Papierkorb oben stabil ist. Es hätte wohl nichts gebracht, die Sachen zu verschenken, denn die, die sich für die Sachen des Historischen Vereins interessieren könnten, haben sie wahrscheinlich selbst im Regal. Oder sie waren mit dem Ausmisten schneller als ich und gucken sich alles online an. Der Rest war einfach uppe; den hätte ich noch nichtmal mehr in die Büchertelefonzelle auf dem Venghaussplatz gestellt.
Bin ich nun mit dem Regal durch?
Nein.
Erstens ist das Frühjahr noch nicht vorbei. Zweitens greift dieses "Weg damit, und zwar jetzt"-Gefühl auch auf andere Lebensbereiche über. Meine Forschungs-Zettelsammlung zum Beispiel. Und sogar auf Dinge, die noch nichtmal aus Papier sind. Erstaunlich. Und das alles nur, weil es draußen länger hell ist und ich ein bestimmtes Buch nicht finden konnte.
Ich habe es übrigens gefunden. An Tag drei. In der linken Hälfte des rechten Regaldrittels auf dem dritten Boden von unten. Hätte eigentlich direkt drauf kommen können. Es war übrigens "Freiheit, Rausch und schwarze Katzen - Eine Geschichte der Bohème" von Andreas Schwab. Das Suchen hat sich gelohnt. Und die Sonderveröffentlichungen des Historischen Vereins dürfen auch bleiben. Die sind nämlich noch nicht online.
Mein Problem ist nun, dass die Papiertonne voll ist und erst in knapp zwei Wochen abgeholt wird. Irgendwas ist halt immer.








 haben und nicht weil ich ein eigenes Zimmer zum Bügeln bräuchte) meiner werten Ansicht nach in den letzten Jahren viel zu viel Papier angesammelt hat, habe ich beschlossen, auszumisten. Wieviel Papier braucht der Familienforscher wirklich...?
haben und nicht weil ich ein eigenes Zimmer zum Bügeln bräuchte) meiner werten Ansicht nach in den letzten Jahren viel zu viel Papier angesammelt hat, habe ich beschlossen, auszumisten. Wieviel Papier braucht der Familienforscher wirklich...?
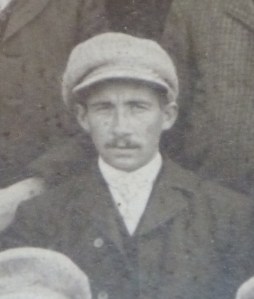 findet?
findet?
